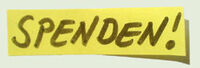Aktuell verhandeln die drei EU-Institutionen Parlament, Rat und Kommission im sogenannten Trilog die offenen Streitpunkte der geplanten NGT-Verordnung. Sie sieht vor, dass Pflanzen der NGT-Kategorie 1 ohne Risikobewertung und Zulassungsverfahren auf den Markt kommen dürfen. Der Anhang I dieser Verordnung legt die Kriterien fest, wann NGT-Pflanzen in die Kategorie 1 fallen. In einer Studie von 2024 hatte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) berechnet, dass 94 Prozent aller NGT-Pflanzen, die derzeit entwickelt werden, diese Bedingungen erfüllen und damit von den Schutzvorschriften des Gentechnikrechts ausgenommen werden würden.
In ihrer aktuellen Arbeit zerlegen die Forschenden des BfN zwei der fünf im Anhang I genannten Kriterien. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass diese Kriterien wissenschaftlich unbegründet sind. Sie würden die genetische Komplexität vereinfachen, den biologischen Kontext von Mutationen missachten und die Funktion geänderter Gene nicht berücksichtigen. Die Folge sei, dass NGT-Pflanzen mit hochkomplexen Erbgutänderungen, die mit herkömmlicher Züchtung nicht erreichbar wären, ungeprüft auf den Markt kämen. Solche Pflanzen könnten ein ähnliches, wenn nicht sogar größeres Risikopotenzial haben als Pflanzen, die mit klassischer Gentechnik hergestellt wurden. Das Fazit des BfN-Teams: Da der für die Einordnung der NGT-Pflanzen maßgebliche Anhang I wissenschaftlich zweifelhaft ist, stellt dies den gesamten Verordnungsvorschlag der EU-Kommission in Frage.
Im Detail kritisiert das BfN-Team zwei Schwellenwerte im Anhang I, die eine NGT-Pflanze einhalten muss, wenn sie in die Kategorie 1 kommen will: Die Pflanze darf an bis zu 20 Stellen im Erbgut verändert werden. Und bei jeder dieser Veränderungen dürfen bis zu 20 Nukleotide, das sind die kleinsten Erbgut-Bausteine, ersetzt oder eingefügt werden. Die europäische Lebensmittelbehörde EFSA hat diese Schwellenwerte damit begründet, dass bei herkömmlichen Pflanzen in jeder Generation ebenso viele Mutationen auftreten können, die entsprechend umfangreich sind. Daraus schloss die EFSA, dass Änderungen in dieser Größenordnung auch natürlich vorkommen oder mit herkömmlichen Zuchttechniken erreicht werden könnten. Also sei auch das Risiko entsprechend gering, wenn solche Änderungen mit NGT herbeigeführt würden.
Dem halten die BfN-Autor:innen entgegen, dass in der Natur Mutationen nicht gleichmäßig über das ganze Erbgut verteilt sind. Ob es zu einer Mutation komme, sei von der Position des Gens und seiner biologischen Wirkung abhängig. Während manche Gene zu natürlichen Mutationen neigen, seien andere gut dagegen geschützt. Auch sei es weniger wahrscheinlich, dass mehrere Mutationen im selben Gen oder zwischen verbundenen Gengruppen auftreten. Viele natürliche Mutationen hätten keine biologische Wirkung, andere würden über mehrere Generationen von der Natur wieder aussortiert.
Während also natürliche Mutationen zufällig auftreten und auch wieder verschwinden können, seien NGT-Manipulationen zielgerichtet und sollen über Generationen hinweg erhalten bleiben. Deshalb sei es schon statistisch unwahrscheinlich, dass solche NGT-Änderungen in der Natur vorkommen, heißt es in der Studie. Die Autor:innen verdeutlichen das mit Lottospielen: Jede Woche gibt es eine Ziehung – sprich eine natürliche Mutation. Doch die Chance, dass es dabei zu sechs Richtigen kommt – also zu sechs genau definierten Änderungen im Erbgut – liegt bei 1 zu 140 Millionen. Noch viel unwahrscheinlicher als 6 aus 49 sind 20 gezielte Änderungen bei Zigtausenden von Genen. Das Fazit der BfN-Studie: „Die vorgeschlagenen Schwellenkriterien in Anhang I beruhen auf vereinfachten und unwissenschaftlichen Annahmen.“
Die Studie weist darauf hin, dass weiterentwickelte NGT-Verfahren tiefe Eingriffe an mehreren Stellen des Erbguts ermöglichen und damit „das Spektrum komplexer genetischer Veränderungen erheblich erweitern“. Trotzdem würden solche NGT-Pflanzen ungeprüft auf dem Markt kommen, solange sie die beiden Schwellenwerte einhalten. Mit künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich sogar gezielt NGT-Pflanzen entwerfen, die noch in die Kategorie 1 fallen, obwohl sie so nie gezüchtet werden könnten. Die Organisation Save Our Seeds (SOS) hat bereits in einem Bericht auf die damit verbundenen Risiken hingewiesen. Die Organisation Testbiotech hat als Beleg dafür von der KI Chat GPT den genetischen Bauplan für einen NGT-Mais entwerfen lassen, der sein eigenes Insektengift produziert und dennoch in die Kategorie 1 fallen würde.
Die BfN-Studie nennt als Beispiel KI-gestützte Veränderungen, durch die eine Pflanze völlig neue Eiweiße produzieren könnte und dennoch ohne Risikoprüfung auf den Markt käme. Hinzu kommt, dass die NGT-Verordnung auch eine Kreuzung verschiedener NGT 1-Pflanzen weiterhin in die Kategorie 1 einordnet. „Ein KI-gestütztes Design ermöglicht mehrstufige NGT-Modifikationen, die neue Merkmale und Proteine schaffen können, die sogar neu für die Natur erscheinen könnten“, heißt es in der Studie.
Indirekt fordern die Autor:innen am Ende ihrer Argumentation, den Trilog zur NGT-Verordnung auszusetzen und neu anzufangen: „Anstatt sich mit dem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zu beeilen, bedarf es eines wissenschaftlich genauen und zukunftssicheren Vorschlags, der potenzielle Risiken berücksichtigt – sowohl aus den beabsichtigten Merkmalen als auch von NGT-Methoden, einschließlich KI-gesteuerter Tools.“ [lf]