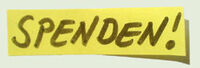Die derzeitigen Gentechnik-Verordnungen der EU verpflichten den Hersteller einer Gentech-Pflanze dazu, mit dem Zulassungsantrag ein Nachweisverfahren vorzulegen. Diese Regelung sollte aus Sicht der Labore in die geplante NGT-Verordnung aufgenommen werden. Ein zusätzlicher Passus soll Unternehmen, die NGT-Pflanzen der Kategorie 1 entwickeln oder herstellen, dazu verpflichten, Nachweismethoden, Referenzmaterial und Daten zur genetischen Veränderung sowie deren genauen Ort im Genom bereitzustellen. In die Kategorie 1 fallen die NGT-Pflanzen, die künftig ohne Zulassung und Risikoüberprüfung auf den Markt kommen sollen. Das seien 94 Prozent aller NGT-Pflanzen, an denen derzeit geforscht werde, schreiben die Labore.
Für diese Pflanzen sieht die geplante NGT-Verordnung ein Anmeldeverfahren vor, in dem die Behörden entscheiden, ob es sich um eine Pflanze der Kategorie 1 handelt. In diesem Verfahren sollten auch die Nachweisunterlagen verpflichtend vorgelegt werden. „Dies würde es uns ermöglichen, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, die wissen möchten, ob sich NGT in ihren Wertschöpfungsketten befinden“, schreiben die Labore. Diese Forderung nach Transparenz werde von allen ihren Kunden geteilt, nicht nur von denen aus dem Bio- oder Ohne Gentechnik-Sektor. Das Thema sei „für große Teile der Lebensmittelindustrie von wesentlicher Bedeutung“.
Sollten sich die Trilogparteien nicht auf eine verpflichtende Vorlage einer Nachweismethode durch den NGT-Hersteller einigen können, müssten sie es den Laboren zumindest ermöglichen, eigene Nachweismethoden zu entwickeln, heißt es in dem Schreiben. Dazu müssten die Hersteller verpflichtet werden, Referenzmaterial zur Verfügung zu stellen und Informationen über die genetische Veränderung, ihre Sequenz und ihren Ort offenzulegen.
Bisher standen im Trilog die Themen Kennzeichnung und Patente im Vordergrund. Mit ihrer Wortmeldung haben die Labore daran erinnert, dass auch der NGT-Nachweis ein ungelöstes Problem in der geplanten NGT-Verordnung ist. Die EU-Kommission war in ihrem Vorschlag überhaupt nicht darauf eingegangen. Das EU-Parlament hatte, als es seine Position festlegte, Anträge auf verpflichtende Nachweisverfahren abgelehnt. Die EU-Mitgliedsstaaten hatten lediglich in den Erwägungsgründen verpflichtende Nachweisverfahren für NGT 1-Pflanzen erwähnt, nicht aber im Verordnungstext selbst.
Dabei ist unter Fachleuten unstrittig, dass sich auch kleine Eingriffe mit NGT ins Erbgut nachweisen lassen – wenn die Labore wissen, wonach sie suchen müssen. „Wie bei herkömmlichen gentechnisch veränderten Organismen können genom-editierte Lebensmittel nur dann von Kontrolllaboren leicht nachgewiesen und quantifiziert werden, wenn Vorwissen über die veränderte Genomsequenz vorhanden ist, eine validierte Nachweismethode zur Verfügung steht und Zugang zu zertifizierten Referenzmaterialien besteht“, heißt es in einer Literaturübersicht, die im Auftrag der britischen Lebensmittelbehörde erstellt wurde. Deren Autoren machen auch deutlich, dass noch viel Forschung notwendig ist, um solche Nachweismethoden zu entwickeln. Denn es reicht nicht aus, die genetische Änderung selbst nachzuweisen. Ein Testverfahren muss auch sicherstellen, dass diese Änderung keine zufällige Mutation ist, sondern mit einem NGT-Verfahren erzeugt wurde.
Die EU fördert mit elf Millionen Euro zwei Projekte, Darwin und Detective, die solche Nachweistechnologien entwickeln sollen. An Darwin beteiligte belgische und französische Institute veröffentlichten Anfang August eine Studie. Sie hatten untersucht, ob sich mit Hilfe moderner Methoden – wie der vollständigen Analyse des Erbguts, öffentlich zugänglicher Genom-Datenbanken und künstlicher Intelligenz – eine Art genetischer Fingerabdruck für NGT-Pflanzen erstellen lässt. Nach diesem Fingerabdruck suchten sie dann mit Hilfe neuester Techniken wie der Hochdurchsatz-Sequenzierung, mit der sich viele Stellen im Erbgut gleichzeitig untersuchen lassen. Sie erprobten ihr Verfahren erfolgreich an einer Reissorte, bei der zuvor mit dem Verfahren Crispr/Cas an einer Stelle das Erbgut verändert worden war. Art und Ort der Änderung waren den Forschenden bekannt, Referenzmaterial hatten sie ebenfalls zur Verfügung.
Die Wissenschaftler:innen gehen davon aus, dass sich das von ihnen entwickelte Verfahren auch bei anderen Pflanzenarten anwenden lässt, über deren genomische Vielfalt es genug öffentlich zugängliche Daten gibt. Sie schreiben in ihrem Fazit, dass sich die von ihnen entwickelte Teststrategie nicht nur für die Kontrolle durch Behörden eigne. Die dadurch mögliche genaue Identifizierung könne auch für die Patentierung durch das herstellende Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein. Denn ohne einen solchen Nachweis lassen sich auch keine Patentverletzungen rechtssicher beweisen. [lf]