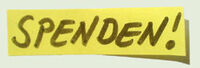Die wichtigsten Bedingungen: Unternehmen, die mit neuen gentechnischen Verfahren (NGT) hergestellte Organismen vermarkten wollen, müssen genau angeben, was sie geändert haben. Ferner müssen sie Referenzmaterial für Untersuchungen bereitstellen, wie es das bestehende EU-Gentechnikrecht für klassische gentechnische Verfahren vorschreibt. Das würde „die Entwicklung robuster, wissenschaftlich fundierter Überwachungssysteme beschleunigen“ und die Kosten für Vollzugsbehörden sowie Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen erheblich reduzieren, schrieben die Darwin-Forscher:innen im September in einem „policy brief“, also einer Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger:innen.
In dem Projekt arbeiten Wissenschaftler:innen aus mehreren europäischen Ländern mit finanzieller Unterstützung der EU daran, Nachweismethoden für NGT-Pflanzen zu entwickeln. Als Modell dienen ihnen dabei Reis- und Tomatenpflanzen, sowie daraus hergestellte Reisnudeln und Ketchup. Die Forschenden stellten fest, dass bestehende Nachweismethoden, die auf der Polymerase Kettenreaktion (PCR) basieren, so angepasst und weiterentwickelt werden können, dass sie auch NGT-Pflanzen erkennen können. Allerdings gilt dies nur, wenn die gentechnische Veränderung bekannt ist, die Labore also wissen, wonach sie suchen müssen. An ihre Grenzen kommen die Methoden bei sehr kleinen Eingriffen, wenn etwa in einem Gen nur ein einzelner Erbgutbaustein ersetzt wird.
Doch auch solch winzige Änderungen lassen sich aufspüren, wie die Wissenschaftler:innen an einer eigens dafür entwickelten NGT-Reispflanze zeigten. Sie kombinierten Methoden zur vollständigen Analyse des Erbguts (Whole-Genome-Sequencing), künstliche Intelligenz und öffentlich zugängliche Genom-Datenbanken. Daraus entwickelten sie eine Art genetischen Fingerabdruck der veränderten Reispflanzen. Nach diesem Fingerabdruck suchten sie dann erfolgreich mit Hilfe neuester Techniken wie der Hochdurchsatz-Sequenzierung, mit der sich viele Stellen im Erbgut gleichzeitig untersuchen lassen. Mit solchen genetischen Fingerabdrücken ließen sich auch andere NGT-Pflanzen eindeutig identifizieren, heißt es in dem Briefing. Zwar müssten die Methoden noch weiterentwickelt und validiert werden, „doch stellt dieser Ansatz einen bedeutenden Schritt dar, um gentechnisch veränderte Organismen zuverlässig zu erkennen“.
Damit solche neuen Methoden möglichst bald zur Verfügung stehen, brauche es zunächst kontinuierliche öffentliche und private Investitionen, lautet eine weitere Empfehlung an die Politik. Wie bei früheren Fortschritten in der Sequenzierungstechnologie sei zu erwarten, dass die Kosten für die Verfahren im Laufe der Zeit deutlich sinken werden. Explizit erinnern die Darwin-Expert:innen die Politik daran, warum die Ergebnisse ihres Projekts wichtig sind: „Zuverlässige Nachweismethoden sind unerlässlich, um dokumentationsbasierte Rückverfolgbarkeitssysteme zu ergänzen, Transparenz in der Lebensmittelkette zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher zu erhalten.“
Dass die Forschenden ihre ersten Ergebnisse in der für solche Projekte unüblichen Form eines politischen Briefings veröffentlichen, hat einen Grund: Vertreter:innen von EU-Parlament, Mitgliedstaaten und EU-Kommission verhandeln seit Monaten im Trilog hinter verschlossenen Türen über die verbleibenden Streitpunkte der geplanten NGT-Verordnung der EU. Diese soll NGT-Pflanzen weitgehend von Zulassung und Risikoprüfung freistellen. Auch müssten Unternehmen, die NGT-Pflanzen herstellen, keine Nachweisverfahren, kein Referenzmaterial und keine detaillierten Informationen zur genetischen Veränderung hinterlegen. Gentechnik-Befürworter:innen rechtfertigten dies damit, dass NGT-Verfahren nicht nachweisbar seien, erläuterte der Verein Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG). Die Darwin-Ergebnisse dagegen untermauerten, dass nur fehlende Informationen die Entwicklung von Nachweisverfahren unnötig verkomplizierten. „Erst-Inverkehrbringer müssen auch bei einem geänderten Zulassungsverfahren verpflichtet werden, detaillierte Informationen über die gentechnischen Veränderungen zu veröffentlichen“, forderte deshalb VLOG-Geschäftsführer Alexander Hissting.
Ähnlich formulierte es die Europäische Vereinigung der gentechnikfreien Wirtschaft, ENGA: „Jetzt liegt es an den politischen Entscheidungsträgern. Die neue Gesetzgebung muss von den Entwicklern verlangen, dass sie Daten zu genetischen Veränderungen offenlegen.“ Auch seien öffentliche Investitionen von entscheidender Bedeutung, um umfassende Genomdatenbanken aufzubauen und Nachweismethoden zu entwickeln. Ob die Darwin-Erkenntnisse die laufenden Trilogverhandlungen noch beeinflussen werden, wird sich zeigen müssen. Derzeit wird in technischen Treffen an Kompromisse zu Punkten wie Gleichwertigkeit, Nachhaltigkeit und Patente gearbeitet. Im November oder Dezember soll es einen zweiten und letzten Trilogtermin unter dänischer Ratspräsidentschaft geben. Einigen sich Rat, Parlament und EU-Kommission dann nicht auf einen gemeinsamen Entwurf, wird das Dossier an die zypriotische Präsidentschaft weitergereicht. [lf]