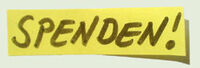Das Moratorium (Motion 133) beantragt hatte die französische Umweltorganisation Pollinis, unterstützt von weiteren Organisationen aus Benin, Kanada, Ecuador, Pakistan und der Schweiz sowie dem Deutschen Naturschutzring, vertreten durch seine Mitgliedsorganisation Zukunftsstiftung Landwirtschaft mit ihrer Kampagne Save our Seeds. Weitere 90 Organisationen weltweit unterstützten die Forderung nach einem „Moratorium für synthetische Biologie und damit verbundene technologische Ansätze“. Gelten sollte es für „genetisch veränderte wildlebende Organismen in natürlichen Ökosystemen“, für „veränderte mikrobielle Gemeinschaften“ und für gentechnisch veränderte Organismen mit einem Gene Drive, der die Vererbung beschleunigt. Auch sollten keine neuen genetischen Elemente in natürliche Ökosysteme eingebracht werden.
Bis fast zum Schluss des Kongresses wurde darüber verhandelt und der Antrag weiter spezifiziert. In der letzten Fassung stand sogar der Verzicht auf das Wort Moratorium im Titel zur Debatte. Am Ende fehlten den Befürworter:innen eines Moratoriums nur zwei Stimmen aus der Gruppe der Mitgliedstaaten der IUCN. Diese hatten die Motion 133 mit 87 Ja zu 88 Nein-Stimmen abgelehnt. Enthaltungen, es waren 32, berücksichtigt die IUCN beim Ergebnis nicht. Zwei Stimmen aus dem Lager der unentschiedenen Staaten hätten also für eine Mehrheit gereicht. Bei der zweiten Gruppe, den Nichtregierungsorganisationen, gab es mit 407 zu 323 Stimmen bei 102 Enthaltungen eine Mehrheit für ein Moratorium. Damit ein Antrag als angenommen gilt, hätten jedoch beide Gruppen zustimmen müssen.
Angenommen wurde dagegen die Motion 87, die für die IUCN einen Rahmen für den Umgang mit gentechnischen Anwendungen zu Naturschutzzwecken formuliert. Sie betont deren Chancen und Risiken gleichwertig und plädiert für eine Fall zu Fall-Entscheidung, der eine „strenge, umfassende und transparente“ Risikobewertung zugrunde liegen soll. Deren Detailschärfe soll „der Bedeutung der Risiken und Vorteile entsprechen, beabsichtigte und unbeabsichtigter Auswirkungen, Wechselwirkungen sowie kurz- und langfristiger Effekte umfassen. Betont wird auch die notwendige „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ betroffener indigener Völker und lokaler Gemeinschaften sowie deren faire und gerechte Beteiligung an möglichen Erträgen.
Entstanden ist dieses Papier in einer Arbeitsgruppe, die vom Weltnaturschutzkongress 2021 in Marseille eingesetzt wurde. An ihr beteiligten sich zahlreiche Gentechnikbefürworter:innen. Viele Umweltorganisationen kritisierten den Prozess als intransparent und unausgewogen. Der IUCN dagegen sprach vom „umfassendsten und partizipativsten Konsultationsprozess“, den die Organisation jemals durchgeführt habe. Das Ergebnis sei ein ausgewogener Rahmen, der Innovationen ermögliche, aber darauf bestehe, dass diese vorsorglich überprüft würden. Positive Kommentare kamen von IUCN-Mitgliedern wie der Wildlife Conservation Society, aber auch vom Netzwerk der Gene Drive Forschenden. Sie wollen mit Gentechnik invasive Arten bekämpfen, gefährdete Arten retten oder Insekten auslöschen, die Krankheiten übertragen.
Für Save our Seeds wies Franziska Achterberg darauf hin, dass risikoreiche Anwendungen wie Gene Drives Arten dauerhaft verändern oder ausrotten und damit Kettenreaktionen in ganzen Ökosystemen auslösen können. „Offenbar setzen viele IUCN-Mitglieder auf Risikotechnologien mit ungewissem Ausgang. Doch die Natur kann sich solche Experimente mit potenziell schwerwiegenden und irreversiblen Folgen nicht leisten“, kommentierte sie das Abstimmungsergebnis. Dies sehen auch 100 Forschende so, darunter zahlreiche prominente Biodiversitätsexpert:innen, die sich für das Moratorium ausgesprochen hatten. Sie schrieben, dass es keinen soliden Rahmen gebe, der sichere Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen in die Natur gewährleiste. „Die potenziellen Auswirkungen solcher Technologien auf die Natur – einschließlich auf Bestäuber, Ökosysteme und Nahrungsnetze – sind weitgehend unbekannt und können mit den derzeitigen wissenschaftlichen Mitteln nicht zuverlässig bewertet werden“, heißt es in ihrer Stellungnahme. [lf]