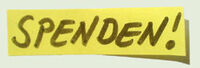Théo Grataloup kam mit deformiertem Kehlkopf und ohne Stimmbänder auf die Welt, Luft- und Speiseröhre waren verwachsen. Das war 2007. Heute, 55 Operationen später, atmet und spricht der 18-jährige durch ein Loch im Hals. Théo und seine Eltern machen den Herbizidwirkstoff Glyphosat für die Missbildungen verantwortlich. Seine Mutter Sabine hatte mit dem Spritzgift den Reitplatz ihres Pferdestalles unkrautfrei gehalten. Und sie setzte das glyphosathaltige Herbizid Glyper auch ein, als sie noch nicht wusste, dass sie schwanger war. Schon der Arzt, der mit einer Notoperation das Leben des Babys rettete, vermutete, dass äußere Einflüsse dafür verantwortlich seien und tippte auf Pestizide.
Sabine Grataloup begann zu recherchieren und stieß auf Studien aus Argentinien, die einen Zusammenhang zwischen Glyphosat und vorgeburtlichen Fehlbildungen herstellten. Damals glaubte sie noch, der Glyphosathersteller Monsanto, heute eine Bayer-Tochter, wisse das nicht. Doch 2017 belegten interne Papiere, dass Monsanto die Risiken seines Produkts frühzeitig bekannt waren. „Da wurde uns klar, dass sie nicht nichts wussten, sondern dass sie wissentlich die Giftigkeit verschwiegen haben. Das hat uns richtig sauer gemacht und wir haben beschlossen zu klagen“, sagte Sabine Grataloup 2018 dem Deutschlandfunk.
Im März 2022 sprach der französische Fonds zur Entschädigung von Pestizidopfern Théo eine monatliche Rente von rund 1.000 Euro zu. Dessen Expert:innen waren zu dem Schluss gekommen, dass die „Möglichkeit einer Kausalität“ zwischen Pestizideinsatz und Missbildung bestehe. Es war das erste Mal in Frankreich, dass eine vorgeburtliche Missbildung als Pestizidschaden anerkannt wurde. Eine Entscheidung, die der Familie Grataloup Hoffnung für die gerichtliche Auseinandersetzung machte.
Doch das Zivilgericht im französischen Städtchen Vienne wies die Klage zurück. Es argumentierte, die Familie habe keinen ausreichenden Beweis dafür erbracht, dass Sabine Grataloup tatsächlich Glyphosat verwendet habe. Ihre Aussagen „werden durch keine Rechnungen oder andere Belege gestützt, die den Kauf eines Kanisters Glyper im Sommer 2005 belegen, der im Sommer 2006 verwendet worden sein könnte“, zitierte das Portal Vert (deutsch: Grün) aus der Urteilsbegründung. Es sei fast unmöglich, solche Beweise zu erbringen, sagte Sabine Grataloup gegenüber Vert und sprach von einer großen Enttäuschung.
„Es ist dringend notwendig, dass der Gesetzgeber Pestizid-Opfer mit Gesetzen schützt, die diese Beweisschwierigkeiten und die Strategien der großen Chemiekonzerne zur Verwässerung ihrer Verantwortung berücksichtigen“, forderte sie gegenüber Vert und kündigte an, in Berufung zu gehen. Auftrieb gibt ihr die aktuelle Diskussion über den Umgang mit Pestiziden in Frankreich. Die Regierung will mit einem Gesetz zwei bereits aus dem Verkehr gezogene Insektizide aus der Gruppe der Neonicotinoide wieder zulassen. Zwei Millionen Menschen haben bereits eine Petition dagegen unterschrieben. „Wir waren allein, David gegen Goliath, jetzt sind wir Millionen“, sagten Sabine Grataloup und ihre Mann Thomas in einer Erklärung zum Urteil.
Der Bayer-Konzern hatte bei der mündlichen Verhandlung im April in Vienne erklärt, es gebe keinen kausalen Zusammenhang zwischen Glyphosat und den Missbildungen, der Wirkstoff sei auch nicht als Substanz eingestuft, die Fehlbildungen verursachen könne. Das Unternehmen teilte Ende Juli mit, dass es seine Rückstellungen für Glyphosatklagen in den USA angesichts eines weiteren für den Konzern negativen Urteils um 1,2 Milliarden Euro erhöht habe. Gleichzeitig sei ein größerer Vergleich mit einer Anwaltskanzlei erzielt worden, so dass sich die Zahl der noch offenen Verfahren auf 61.000 reduziert habe, bei insgesamt 192.000 Klagen. Ende Januar 2025 waren es noch 181.000 eingereichte Klagen, von denen noch 67.000 offen waren. Es sind also im letzten halben Jahr 12.000 Klagen neu dazugekommen.
Weitere 530 Millionen Euro neue Rückstellungen bildete der Konzern für die ebenfalls mit Monsanto eingekauften PCB-Altlasten. PCB steht für die Gruppe der extrem gilftigen polychlorierten Biphenyle, die Monsanto in den 60er und 70er Jahren hergestellt hatte. Sie wurden vor allem als Brandschutzmittel eingesetzt, belasteten zahlreiche Gebäude und führten zu Gesundheitsschäden sowie zahlreichen Klagen gegen Monsanto. 200 davon hat Bayer Mitte August mit einem Vergleich beendet, für den diese Rückstellungen gedacht waren. [lf]