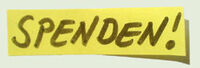In einem Langzeitfütterungsversuch mit Ratten lösten Glyphosat und zwei glyphosathaltige Herbizide des Herstellers Bayer zahlreiche Krebserkrankungen aus. Besonders viele junge Tiere starben an Leukämie, also Blutkrebs. Die beteiligten Forschenden aus Italien, Großbritannien und den USA werteten ihre Ergebnisse als klaren Beweis für die von vielen Behörden immer noch bezweifelte krebserregende Wirkung von Glyphosat. Die Mitte Juni veröffentlichte Arbeit ist Teil einer international angelegten umfassenden Glyphosatstudie, der Global Glyphosate Study (GGS). Koordiniert wird sie von dem für seine Krebsforschung bekannten italienischen Ramazzini-Institut.
Die beteiligten Wissenschaftler:innen hatten je 100 Ratten über zwei Jahre hinweg über das Trinkwasser täglich Glyphosat oder zwei glyphosathaltige Bayer-Herbizide verabreicht: das in der EU zugelassene Roundup Bioflow und das in den USA verwendete Produkt Ranger Pro. Die höchste Dosis mit 50 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht entsprach der Menge, bei der bisher aus Sicht der EU-Lebensmittelbehörde EFSA keine negativen Effekte in Tierversuchen auftraten. Die EFSA hatte daraus abgeleitet, dass es für Menschen unbedenklich sei, wenn sie täglich 0,5 Milligramm Glyphosat je Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Dieser Menge entsprach die niedrigste im Versuch verabreichte Dosis. Die Fütterung begann mit der Schwangerschaft der weiblichen Ratten und ging über zwei Jahre. Üblicherweise dauern Fütterungsstudien für Pestizidzulassungen nur drei Monate. Kritiker:innen bewerten das seit langem als zu kurz, da so Langzeiteffekte schlecht erkennbar seien.
In allen drei Behandlungsgruppen beobachteten die Forschenden eine im Vergleich zur Kontrollgruppe statistisch signifikante und dosisabhängig erhöhte Zahl an gutartigen und bösartigen Tumoren. Sie traten in Leber, Nieren, Knochen, Harnblase, Schilddrüse, Eierstöcken und Milz auf. Besonders hoben die Forschenden die Fälle hervor, in denen die Tumore blutbildendes oder Lymphgewebe befielen, was allgemein als Leukämie bezeichnet wird. Als „äußerst ungewöhnlich“ bezeichneten sie es, dass 40 Prozent der an Leukämie erkrankten Ratten bereits im ersten Jahr starben. Dies könnte daran gelegen haben, dass die Ratten anders als in anderen Versuchen schon als Embryonen über die Mutter und kurz nach der Geburt Glyphosat ausgesetzt waren, vermuten die Wissenschaftler:innen. „Die Ergebnisse verdeutlichen das tumorerzeugende Potenzial von Glyphosat und glyphosathaltigen Produkten bei Dosen, die bisher als sicher galten. Diese neuen Erkenntnisse müssen von den Regulierungsbehörden weltweit sorgfältig geprüft werden", forderte Alberto Mantovani, einer der Studienautoren.
Dem folgte die zuständige Generaldirektion Gesundheit (GD Sante) prompt: Bereits zwei Wochen nach Veröffentlichung der Studie forderte sie die zuständige Lebensmittelbehörde EFSA und die Chemikalienbehörde ECHA schriftlich auf, ihre Risikobewertung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat von 2023 im Lichte der neuen Studienergebnisse zu überprüfen. Bevor die Glyphosatzulassung im November 2023 um zehn Jahre verlängert wurde, hatten ECHA und EFSA keine Risiken für Gesundheit oder Umwelt gesehen, die aus ihrer Sicht dagegensprachen.
Dabei hatte die Forschungsgruppe um das Ramazzini-Institut drei Wochen vor dieser Entscheidung schon erste Schlussfolgerungen aus den damals bereits laufenden Ratten-Versuchen bei einer Tagung vorgestellt (der Infodienst berichtete). Mitte November 2023 hatte sie EFSA und ECHA das vollständige Manuskript der Krebsstudie geschickt. Sie weigerte sich jedoch, den Behörden die Rohdaten zur Verfügung zu stellen. Das hat sich inzwischen offenbar geändert: Wie der Direktor des Ramazzini-Instituts Euractiv sagte, werde man den Regulierungsbehörden auf Anfrage jetzt auch die Rohdaten der Studie zukommen lassen. Auch dass inzwischen externe Expert:innen in einem Peer Review-Verfahren die Ergebnisse bewertet und für die Veröffentlichung in dem renommierten Fachjournal Environmental Health freigegeben haben, könnte für die Behörden relevant gewesen sein.
Laut dem Schreiben der GD Sante soll die ECHA, die sich dafür auch mit den Fachbehörden der EU-Mitgliedstaaten austauschen soll, für ihre Einschätzung 15 Monate Zeit bekommen. Liegt diese vor, hat die EFSA weitere sechs Monate Zeit, um die neuen Ergebnisse zu bewerten. Warum die Prüfung von Erkenntnissen, die schon fast zwei Jahre publik sind, so lange dauert, bleibt unklar. Die EU-Kommission jedenfalls scheint in Sachen Glyphosatzulassung eine gewisse Dringlichkeit zu sehen: Sollte es nötig sein, „wird die Kommission unverzüglich tätig, um die Zulassung zu ändern oder zu widerrufen“, schrieb die Brüsseler Behörde der taz. [lf/vef]