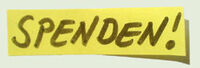Pilzresistente Bananen, krankheitsresistente Cassavawurzeln oder Sorghum-Hirse, die Unkräuter unterdrückt: Das sind einige der mit neuen gentechnischen Verfahren (NGT) in Afrika hergestellten Pflanzen, die aus den Laboren hinaus aufs Feld drängen. Das Afrikanische Zentrum für Biodiversität (African Centre for Biodiversity, ACB) hat zusammengestellt, an was afrikanische Gentechniker:innen gerade arbeiten. Es beschreibt auch, wer diese Arbeiten finanziert und wie die NGT-Befürworter:innen in einer konzertierten Kampagne versuchen, Risikobewertungen und Zulassungsverfahren zu vermeiden.
Die Afrikanische Union, in der fast alle afrikanischen Staaten Mitglied sind, hat sich früh den Versprechungen der NGT-Befürworter:innen in Wirtschaft und Wissenschaft geöffnet und deren Behauptungen übernommen. Wie ACB berichtet, drängen mehrere Gremien der Afrikanischen Union darauf, dass die Mitgliedstaaten rechtliche Regelungen für den Umgang mit NGT erlassen und die Forschung mit NGT ausbauen. Unterstützt werden sie dabei nicht nur von Universitäten und Wissenschaftsvereinigungen in Afrika, sondern auch von Universitäten, Forschungseinrichtungen, Firmen und Stiftungen aus dem Globalen Norden. Der ACB-Bericht nennt allen voran die Stiftung von Bill und Melinda Gates sowie das von ihr und zahlreichen Gentechnikkonzernen unterstützte Donald Danforth Plant Science Center in Saint Louis, USA. Dessen Gründung hat einst auch die Bayer-Tochter Monsanto mit 50 Millionen US-Dollar und einem Baugrundstück unterstützt. Aktiv daran beteiligt, NGT in Afrika voranzubringen, sind auch internationale Agrarforschungsorganisationen wie CGIAR oder IITA, die schwedische Agraruniversität, die Universität von Kalifornien, der Gentechnikkonzern Corteva oder das argentinische Gentech-Unternehmen Bioheuris. Mit Wirkung: „Afrika hat bedeutende Fortschritte dabei gemacht, ein günstiges Umfeld zu schaffen, um landwirtschaftliche Biotechnologien einzuführen und einzusetzen“, heißt es in einem Übersichtsartikel afrikanischer NGT-Befürworter:innen.
Laut ACB-Bericht haben bisher Nigeria, Südafrika, Burkina Faso, Kenia, Ghana, Malawi und Äthiopien im Rahmen ihrer Gentechnikgesetzgebung Regelungen für den Umgang mit NGT erlassen. Sambia, Mosambik und Eswatini bereiten solche Gesetze vor. Mit Ausnahme von Südafrika sehen diese Regelungen vor, dass NGT-Pflanzen, die keine Fremdgene enthalten, von den jeweiligen nationalen Gentechnikregeln ganz oder weitgehend ausgenommen sind. Risikobewertung und Zulassung fallen dadurch weg, in einigen Fällen sind eine vorherige Freigabe oder ein Monitoring möglicher Folgen vorgesehen. In Südafrika dagegen unterliegen NGT-Pflanzen dem Gentechnikrecht mit allen seinen Anforderungen.
In den Ländern mit entsprechender Gesetzgebung und interessierten Forschungseinrichtungen sind einige NGT-Pflanzen entstanden. ACB nennt unter anderem Sorghum, eine Hirseart, die so verändert wurde, dass sie resistent gegen Striga ist, eine parasitäre Pflanze. Sie befällt die Wurzel der Hirse, um sich selbst mit Nährstoffen zu versorgen. NGT-Sorghum wird in Kenia in Feldversuchen getestet. Das kenianische Agrarforschungszentrum Kalro entwickelte einen gegen die Viruskrankheit Lethale Mais-Nekrose toleranten NGT-Mais. Das Saatgut soll laut ACB an 20.000 Kleinbauern zum Testen abgegeben werden. Es gebe keine öffentlich zugänglichen Informationen, ob dies schon geschehen sei, schrieb ACB.
Im benachbarten Äthiopien arbeiten Forschende an einer kurzhalmigen Variante der Zwerghirse Teff, unterstützt von Corteva und dem Donald Danforth Center. Feldversuche fanden in den USA statt, in Äthiopien steht die Genehmigung dafür noch aus. In Nigeria wachsen auf Versuchsfeldern NGT-Cassavapflanzen, die resistent gegen Bakterienfäule sein sollen. Gegen dieselbe Bakterienkrankheit haben Forschende in Burkina Faso Reis tolerant gemacht. Eine Genehmigung, die Pflanzen in Feldversuchen zu testen, liegt vor.
ACB nennt in seinem Bericht auch mit dieser Entwicklung verbundenen Probleme: Risiken würden nicht bewertet, es mangele an Transparenz, die Biodiversität sei gefährdet und Konzerne könnten bald den Saatgutmarkt beherrschen. Allerdings schränkt die Organisation ein, dass es bisher erst wenige Feldversuche gebe und nur minimale Schritte in Richtung Kommerzialisierung. „Es besteht eine große Diskrepanz zwischen Versprechen und Umsetzung“, heißt es im Bericht. Zugleich würden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die öffentliche Akzeptanz der Technologie zu fördern. „In mindestens zehn Ländern wurden Kommunikationszentren eingerichtet, Hunderte von Journalist*innen geschult, Medienpreise ins Leben gerufen und Netzwerke geschaffen“, schreibt ACB. Auch dafür gab es Geld aus dem Globalen Norden. [lf]