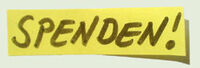Die neuen gentechnischen Verfahren (NGT) wie Crispr/Cas erlauben gravierende Eingriffe ins Erbgut und damit in den Stoffwechsel von Mikroorganismen. Die meisten der neuen gentechnisch veränderten Mikroorganismen (GMM) sind für den Einsatz in Fermentern gedacht. Immer häufiger entwickeln Unternehmen jedoch GMM, die ihre Wirkung auf den Feldern der Bauern entfalten sollen. Das bekannteste Beispiel ist das Bodenbakterium Klebsiella variicola. Es kann für seinen Stoffwechsel Stickstoff aus der Luft fixieren. Die US-Firma Pivot Bio hat das Bakterium gentechnisch so verändert, dass es einen Teil dieses Stickstoffs als Ammonium an Pflanzen abgibt. Das Unternehmen vermarktet es als Zusatz, der helfen soll, Kunstdünger einzusparen. Angeboten werden jeweils speziell designte Bakterien für Mais, Baumwolle, Weizen und Sorghum. Ausgebracht wurden die GMM laut Unternehmen 2024 auf gut fünf Millionen Hektar Fläche. Die Behörden in den USA und in Brasilien haben diese GMM ohne jede Risikoüberprüfung für den Markt freigegeben. Mehrere andere Unternehmen arbeiten ebenfalls an Stickstoff liefernden GMM, haben aber noch keine Produkte auf dem Markt.
Der Mikrobiologe Benno Vogel hat für die Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH) Ende 2024 weitere GMM-Anwendungen zusammengestellt, die für den Einsatz auf dem Acker entwickelt werden. Demnach arbeiten zwei Unternehmen an Bakterien, die gebundenen Phosphor aus dem Boden lösen und ihn den Pflanzen als Nährstoff zur Verfügung stellen können. Bereits auf dem Markt sind laut der EKAH-Studie erste GMM, die zusätzliche Enzyme produzieren, damit sie Pflanzenreste auf dem Acker schneller zersetzen können. So vermarkte BASF in den USA und Kanada den von Bayer entwickelten Bacillus thuringiensis EX297512. Er produziert eine Glucanase, also ein Enzym, das Pflanzenreste in Glukose umwandelt, die wiederum weitere Bodenbakterien anlockt, die sich davon ernähren.
Gearbeitet wird in den Laboren laut Vogel-Bericht auch an GMM, die Pflanzen helfen sollen, mit abiotischem Stress wie Trockenheit oder salzigen Böden besser fertig zu werden. Das US-Unternehmen BioConsortia entwickele GMM, die als Pestizide oder Saatgutbeize Pflanzen gegen Pilze und Nematoden (Fadenwürmer) schützen sollen. Nach Angaben des Unternehmens stehen einige Produkte vor der Vermarktung. Mehrere US-Unternehmen hätten GMM in der Pipeline, die dazu beitragen sollen, dass mehr Kohlendioxid im Boden gespeichert werden kann. Etwa indem sie Zellulose produzieren oder zur Verwitterung von Gestein beitragen, schrieb Vogel. Da die Kohlenstoffeinlagerung auf Ackerböden zunehmend als Geschäftszweig (Carbon Farming) gesehen wird, könnten solche GMM für Landwirt:innen wirtschaftlich interessant sein. In den USA, Kanada und Brasilien gelten solche Anwendungen als genehmigungsfrei, solange sie keine Transgene enthalten.
In der EU wären Freisetzungen solcher GMM nach geltendem Recht zulassungspflichtig. Daran würde auch die NGT-Verordnung nichts ändern, die derzeit von den EU-Gremien im Trilog diskutiert wird. Denn sie gilt nur für Pflanzen. Die EU-Lebensmittelbehörde EFSA hat im Sommer 2024 einen Bericht über die Anwendung von gentechnisch veränderten Mikroorganismen in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion veröffentlicht. Sie sieht in GMM kein neues Risiko und hält es für ausreichend, die bestehenden Leitlinien für die Risikobewertung anzupassen.
Diese Einschätzung halten gentechnikkritische Organisationen und einige Behörden von Mitgliedstaaten für falsch. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Abschätzung der Umweltrisiken von GMM eine größere Herausforderung darstellt als bei gv-Pflanzen“, heißt es in einer Studie des österreichischen Umweltbundesamtes und des deutschen Bundesamtes für Naturschutz. Denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Ökologie solcher GMM seien sehr begrenzt. Als mögliche Risiken nennen die Expert:innen den horizontalen Gentransfer, also die Weitergabe des veränderten Erbguts an andere Bodenbakterien. Möglich seien auch unerwünschte Nebenwirkungen bei anderen Pflanzen oder Veränderung der Mikrobengemeinschaft im Boden. Die Studie kommt zu dem Schluss, „dass die bestehenden Leitlinien für die Risikobewertung und Überwachung von GMM nicht ausreichen, um die mit Produktionssystemen und der Umwelt verbundenen Risiken zu bewerten und zu mindern“. Dafür müssten zuerst geeignete Methoden entwickelt werden. Denn, so betont ein Bericht von Friends of the Earth USA: Diese für den landwirtschaftlichen Einsatz gedachten GMM seien etwas vollkommen Neues, auf das die bisherigen Erfahrungen mit gentechnischen Veränderungen nicht einfach übertragen werden könnten. [lf]